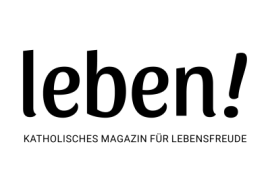Interview mit Markus Wonka, Psychologe und Theologe in Vechta.
Herr Wonka, was macht ein Heimatgefühl aus?
Heimat wird meist dann wichtig, wenn sie verloren zu gehen scheint. Zu einem Heimatgefühl gehört ein geografisch-lokaler Aspekt, dann die Identität. Und der dritte Faktor hat mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Das bedeutet: In meiner Zugehörigkeit und in meiner Identität bin ich wer.
Es geht also weit über den geografischen Blickwinkel hinaus …
Heimatgefühl geht viel tiefer. Das sind zum Beispiel Naturerfahrungen: Wie ist die Landschaft in einer Gegend? Wie ist dort das Licht, wie gestalten sich die Jahreszeiten? Diese Erfahrungen und Erinnerungen berühren viel tiefere Schichten des Menschseins als die reine Geografie. Dazu kommt: Wie ist die Bauweise, die Architektur? Auch die Sprache spielt eine Rolle. Aus all diesen Faktoren entwickelt sich ein tiefes Gefühl: „Ich fühle mich dort zugehörig.“
Ist es möglich, Heimweh zu lindern – und wie?
Es ist nicht medikamentös zu behandeln, kann sich aber bessern, wenn Aspekte von Heimat erfahren werden. Aber oft ist Heimweh nicht zu lindern.
Was meinen Sie mit „Aspekte von Heimat“?
Dass ich in der Fremde zum Beispiel entsprechende Restaurants aufsuche. Dass ich die Wohnung so gestalte, dass sie mich an die Heimat erinnert. Wir können ja über unsere sozialen Medien Kontakt mit der Heimat halten. Das kann lindern. In früheren Zeiten bedeutete die Abwesenheit von der Heimat wirklich Abwesenheit. Menschen können sich da entwurzelt fühlen.
Wenn man an die Flüchtlinge aus Syrien denkt – oder auch an die Heimatvertriebenen im Zweiten Weltkrieg: Ist es möglich, eine neue Heimat zu finden, die die alten Heimatgefühle dauerhaft ersetzt?
Viele haben ja bei Flüchtlingen die Vorstellung, dass sie aus wirtschaftlichen Erwägungen die Heimat verlassen. Doch die meisten wünschen sich eigentlich Frieden und eine gesicherte Existenz in ihrer Heimat. Es ist möglich, sich an einem neuen Ort ein Leben einzurichten, wo man sich sicher, geborgen und wohl fühlen kann. Aber das Gefühl von Heimat ist zumindest für die direkt betroffene Generation meist nicht wieder herstellbar. Die Menschen bleiben verbunden mit ihrer alten Heimat. Daher pflegen Migranten häufig in ihrer neuen Umgebung das Brauchtum der bisherigen Heimat. In unseren Bereichen haben sich die fremdsprachigen Missionen ein Stück Heimat geschaffen.
Der Begriff Heimat ist wieder besonders angesagt. Könnte das auch mit dem Wunsch zu tun haben, sich abzugrenzen?
Heimat hat immer mit Abgrenzung zu tun – im positiven Sinn. Ich kann mich nicht beheimatet fühlen in der Welt als solcher. Heimatbezüge sind vergleichsweise klein. Grenzziehung im Sinn einer Ablehnung des Fremden wird dann stärker, wenn man die eigene Heimat vermeintlich Schwinden sieht. Viele Psychologen sehen das so. Da spielen die Migrationsbewegungen der letzten Jahre und Jahrzehnte eine Rolle, und auch wirtschaftlich-gesellschaftliche Veränderungen mit ihren Anforderungen an Flexibilität und Mobilität.
Hinzu kommt ein Verlust an Vielfalt: Unsere Ernährung wird einheitlicher, wie es sich in den vielen Fast-Food-Ketten zeigt. Unser Kleidungsstil wird global einheitlicher. Dialekte und Sprachfärbungen gehen zurück. Regionale Eigenheiten nehmen tendenziell ab.
All das führt dazu, dass sich der Eindruck breitmachen kann: Die Heimat geht verloren. Da kommt die Frage auf: Wozu gehöre ich dann? Und wenn dann Migrationsbewegungen auf eine so in Teilen verunsicherte Gesellschaft stoßen, wird es schwierig. Dann braucht es ein Heimatministerium!
Trifft die Verunsicherung auch auf die Kirche zu – besonders in Zeiten der Fusionierung von Gemeinden?
Viele sagen ja, dass ihnen dadurch ein Stück Heimat abhandengekommen ist.
Wir leben insgesamt in einer Gesellschaft, in der Bindekräfte von Institutionen schwächer werden. Kirche war immer eine große Kraft im Sinne der Beheimatung. Zusammenlegung von Pfarreien erleben viele Menschen als Verlust von Zugehörigkeit. Und bei jeder Kirchenschließung besteht die Gefahr, dass ein Stück Heimat verlorengeht.
Kann man den Menschen in den großen Pfarreien ein neues Heimatgefühl vermitteln?
Zumindest nicht kurzfristig. Wenn man sieht, wie alt oft die Ursprungspfarreien waren, wie sich eine örtliche Identität über viele Jahrhunderte entwickelt hat und die Kirche verbunden ist mit dem Leben im Stadtteil oder im Dorf, dann ist es nur schwer vorstellbar, diese Identität einfach auf eine größere Einheit zu übertragen. Wahrscheinlich ist eher, dass innerhalb einer größeren Pfarrei verschiedene Formen von Gemeinden Menschen weiterhin eine Heimat geben können.
Was ist dabei zu beachten?
Bei einer Großpfarrei glaube ich nicht, dass sie ohne Weiteres die gleiche Funktion an Integration und Beheimatung einnehmen kann wie die bisherigen Altpfarreien. Das wäre eine Überforderung. Innerhalb der Großpfarrei sollte deshalb überlegt werden: Wie kann Gemeindeleben stattfinden, gefördert werden und sich weiter entfalten – was dann auch wieder Zugehörigkeit, Beheimatung und Identität schaffen kann? Aber eben nicht in Abgrenzung zur Großpfarrei, sondern als eine Pfarrei, die eine große Vielfalt zulässt und integrieren kann.