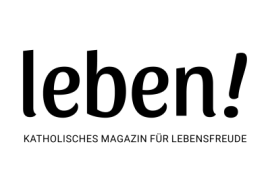Ein totes Kind zerreißt die Welt. Uli Michel kennt das aus ihrer Arbeit mit Eltern von „Sternenkindern“, die vor, während oder kurz nach der Geburt starben. Sie hat sich zur Sterbeamme ausbilden lassen. Weil sie die große Sprachlosigkeit nicht akzeptieren wollte, die sie als Hebamme in diesen Situationen erlebt.
Luisa, Emma und Mattis sind dabei in diesem Stuhlkreis. Ohne ihre Kinder wäre es für die Eltern nicht möglich, dort Platz zu nehmen. Ohne ihre Kinder würden die Gespräche alle vier Wochen keinen Sinn machen. Ohne ihre Kinder würde die helfende Zeit in dieser Runde zur großen Leere werden. Sie müssen dabei sein – in Gedanken, Erinnerungen, in ihren Herzen.
Mattis starb im Bauch seiner Mutter, Emma überlebte ihre Geburt nicht, Luisa starb wenige Wochen nach ihrer Geburt. „Es ist ein stetiger Kampf für mein unsichtbares Kind“, sagt eine der Mütter. „Ich will dafür kämpfen, dass es gesehen wird, dass es nicht totgeschwiegen wird.“ In den alltäglichen Begegnungen ist diese Erinnerung einige Monate nach den Schicksalsschlägen längst nicht mehr der Normalfall. Im Gespräch mit Verwandten, Freunden und Arbeitskollegen muss sie oft eingefordert werden. „Ich will aber, dass es selbstverständlich ist.“
Die Wucht der Gefühle ist enorm und hat kaum etwas an Kraft verloren. Das ist in dieser Runde deutlich zu spüren. Mal kommen die Worte gebrochen mit dem Blick zum Boden, mal energisch mit Wut in der Stimme, mal mit einem Lächeln in Gedanken an die Zeit vor dem Schicksalsschlag. Uli Michel kennt diese Gemengelage aus ihren vielen Begegnungen mit Familien in dieser Situation. Sie ist Hebamme, hat einige Zeit einen Hospiz-Dienst geleitet und ist Trauma-Fachberaterin. Und sie ließ sich zur „Sterbeamme“ ausbilden, mit dem Ziel, Sterbende und ihre Angehörigen zu begleiten. Ihre Hauptzielgruppe dabei sind „Sternenkinder-Eltern“, deren Kinder vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind. „Sie erleben eine Zerrissenheit, die kein Außenstehender mitfühlen kann.“
Auch sie selbst nicht, sagt die 50-jährige Mutter zweier erwachsener Kinder. Sie kann den natürlichen Reflex vieler Menschen nachvollziehen, wenn sie mit einer solchen Situation konfrontiert werden: „Wegsehen, weglaufen, nicht wahrhaben wollen.“ Für sie kam Wegducken nie in Frage. Vielleicht weil sie so erzogen wurde, als Tochter eines evangelischen Pfarrers. „Wenn es Not gab, wurde gehandelt – Ignoranz gab es nicht.“ Ihre Freunde beschreiben sie so: „Du gibst dich nicht damit zufrieden, wenn etwas nicht stimmt.“ Ein „Ist halt so“ kennt sie nicht.
Not erlebte sie von Beginn an auch in ihrem Beruf als Hebamme, sagt Michel. „Mehr als viele weinen – da geht es nicht nur um das große Glück der Geburt.“ Sie überlegt kurz und präsentiert mit einer abwägenden Handbewegung eine Hochrechnung: „Halbe, halbe. Die Hälfte sind wunderbare Erfahrungen vom Anfang des Lebens, die andere Hälfte schwere und traurige Ereignisse.“ Sie spricht vom „ganzen Elend der Welt“, das auch vor dem Kreißsaal nicht Halt macht. Von Gewalt-Erfahrungen, Schmerzen und Ängsten, mit denen die Frauen dorthin kommen. Von Behinderungen, Krankheiten und Tod der Kinder. Und sie spricht energisch von einer großen Hilflosigkeit vieler Menschen in dieser Situation.
Die war der Auslöser für den Weg, den sie einschlug. Sie erinnert sich an ihr erstes Praktikum, das sie mit 22 Jahren in einem Krankenhaus im Ruhrgebiet machte. Im Kreißsaal erlebte sie die Kaiserschnitt-Geburt eines Kindes, das unerwartet mit schwerer Behinderung zur Welt kam. „Die Hebamme brach zusammen und verließ den Raum, der Arzt war überfordert, die Pfleger überlastet.“ Die Mutter wurde sediert, keiner fand den Mut, die Situation mit ihr aufzuarbeiten. Als Michel in der Nacht am Bett der Frau saß, dachte sie über diese Sprachlosigkeit nach. „Seitdem beschäftigte mich die Angst aller Beteiligten.“
Eine solche Flucht oder ein Erstarren ist für die Eltern in ihrer Gesprächsrunde besonders schmerzhaft. Weil das weit weg ist von der ständig präsenten Sehnsucht, mit der sie seit dem Tod ihrer Kinder leben. „Es ist wie ein unglaublicher Liebeskummer, nur viel existenzieller“, sagt eine Mutter. Omnipräsent, in allen Gedanken und Gefühlen. „Alle anderen Wünsche, die ich hatte, sind verschwunden.“
Kommen sie wieder, entstehen oft Schuldgefühle. „Ich habe die Sehnsucht, dass die Sehnsucht nach meinem Kind nie aufhört“, sagt eine andere Mutter. „Auch wenn sie mit Tränen verbunden ist.“ Ihr Mann hält ihre Hand und nickt. „Ich will einfach nicht akzeptieren, dass es Dinge gibt, die wichtiger werden können als die Verbindung zu meinem Kind.“
In jedem Gedanken bleibt das Kind „ein wenig am Leben“, sagt Uli Michel. Sie weiß, dass dies Gedanken sind, die ausgrenzen können. Nicht weil die Familie, die Nachbarn oder die Kollegen bewusst die Nase rümpfen. Sondern weil sie mit dieser ungeheuren Wucht der Situation überfordert sind. Wie die Hebamme im Kreißsaal bei der Geburt des Kindes mit Behinderung.
So verständlich das ist, so wenig wollte Michel das akzeptieren. Gerade bei jenen, die in dieser Situation an der Seite der Betroffenen stehen sollten. Dazu zählt sie auch sich selbst als Hebamme. Als sie einmal mit ihrem Vater über die Hilflosigkeit beim Tod eines Kindes sprach, sagte er etwas, das ihr im Gedächtnis blieb: „Die schwersten Momente für mich als Pfarrer sind die, wenn ich hinter einem kleinen weißen Sarg hergehen muss – für diese Augenblicke habe ich nie eine Ausbildung bekommen.“
Es geht um Professionalität – bei allen Emotionen, die auch für Michel dazu gehören. „Die sind wichtig und müssen auch bleiben.“ Kein durchstrukturiertes Handeln ohne Herz, aber die Möglichkeit, mit der richtigen Ansprache und geeigneten Methoden reagieren zu können. „Da gibt es in Deutschland wenig Angebote“, sagt sie. „Nur ein kleines Netzwerk engagierter Seelsorger, Hebammen und Ärzte.“
Sie selbst suchte die Professionalität, bildete sich fort, belegte Kurse. Ihre Berufserfahrung aus vielen Jahren als selbstständige Hebamme ergänzte sie nach und nach mit dem Wissen aus der Palliativmedizin, Psychologie, aus der Trauerbegleitung, Hospiz-Arbeit und Traumatherapie. Das alles floss nach und nach zusammen und mündete 2019 in die Leitung der Sternenkinder-Beratungsstelle Münster-Osnabrück. Getragen wird die Einrichtung von der Bethanien-Diakonissen-Stiftung, die Angebote für die Klienten sind kostenlos. Sie reichen von der Vorbereitung auf eine Geburt, bei der das Kind sterben wird, über Rückbildungsgymnastik nach Totgeburten bis zu Einzel- und Gruppengesprächen sowie Fortbildungen.
Ihr Arbeitsplatz ist ein Neubau in einem Wohngebiet von Lengerich. Die Wohnung ist sichtbar nicht als Beratungsstelle konzipiert worden. Sekretariat, Besprechungs- und Sitzungsräume haben Platz in Zimmern gefunden, die als Schlafzimmer, Büroraum oder Wohnküche geplant waren. „Mir war so eine lebensnahe und lebendige Umgebung wichtig.“ Jetzt sitzt sie dort mit den Eltern im Kreis um ein Blumengesteck. Durch die bodentiefen Fenster scheint die Sonne auf das helle Parkett. Auf dem Küchenblock im Hintergrund stehen kühle Getränke.
Passt diese lichtdurchflutete Wohnatmosphäre zum Thema? Was hat so viel Sonne mit der Tragik der Sternenkinder zu tun? „Sie sind Lichtpunkte, so schwarz der Hintergrund auch ist“, sagt Michel. Wie hell diese Punkte leuchten können, ist unübersehbar. Immer dann, wenn die Eltern sich an Momente erinnern, in denen sie die Schwangerschaft oder die ersten Wochen mit ihrem Kind unbeschwert genießen konnten. „Wenn wir über Land fahren und es nicht so toll riecht“, beschreibt die Mutter von Luisa einen solchen Augenblick. „Da hat sie immer die Nase gerümpft.“ Es sind auch Momente, in denen sie erleben, dass andere ihre verstorbenen Kinder eben nicht vergessen. Als der Cousin von Luisa zu Besuch war, sagte er, dass das Rollo vom Dachfenster doch aufbleiben müsste. „Sonst könne sie uns doch nicht sehen“, erinnert sich die Mutter. „Dann spüre ich, dass sie noch lebt.“
Es wird gelacht. Nicht ständig, aber immer mal wieder – auch beim anschließenden Eiskaffee am Küchenblock. Völlig gelöst ist die Stimmung nie. Dafür müssten sich die Eltern von der Sehnsucht nach ihren verstorbenen Kindern lösen. „Darum geht es nicht“, sagt Michel. „Die Bindung wird sich nicht verlieren.“ Der Blick darauf soll aber nicht schwarz bleiben. Das treibt sie an. Weil sie Wege durch das Leid erlebt, die gut enden. Auf denen ungeahnte Kräfte entstehen, Mut wächst und Lebensfreude zurückkehrt. Und weil sie dabei als Sterbeamme genauso viele schöne Momente erleben darf, wie sie als Hebamme im Kreißsaal erlebte. „Wenn Eltern ihre Traurigkeit endlich in Worte fassen können, wenn sie weinen können oder wenn ich sehe, mit wie viel Liebe ein Paar die Situation meistert.“